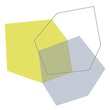Methoden der Psychotherapie und Beratung
Im Folgenden haben wir Informationen zu den in unserer Praxis eingesetzten Methoden und Verfahren zusammengestellt. Grundlage unserer psychotherapeutischen Arbeit bildet die Kognitive Verhaltenstherapie, zu der Sie nachfolgend wesentliche Informationen finden. Einzelne Therapeut*innen verfügen darüber hinaus über Weiterbildungen in spezifischen Verfahren, die wir Ihnen im Anschluss vorstellen.
Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)
Die Verhaltenstherapie ist eine wissenschaftlich gut abgesicherte psychotherapeutische Methode, die seit Jahrzehnten weltweit große Anerkennung erfährt. Sie bildet die Grundlage unserer Arbeit. Gesetzliche und private Krankenkassen übernehmen die Kosten für diese Therapie, wenn ein Bedarf festgestellt wird und bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Die kognitive Verhaltenstherapie umfasst eine Vielzahl von Methoden und Verfahren, deren Wirksamkeit vielfach wissenschaftlich überprüft ist. Ziel ist es, Patient*innen nach Einsicht in Ursachen, Entstehungsgeschichte und Hintergrundfaktoren ihrer Schwierigkeiten Methoden an die Hand zu geben, mit denen sie Lebensprobleme und Symptome bewältigen können. Die Therapie versteht sich dabei als angeleitete Hilfe zur Selbsthilfe. Beispielsweise können Personen, die unter Angststörungen leiden, mittels Konfrontationsverfahren lernen, mit ihren Ängsten besser umzugehen.
Seit den 1990er Jahren hat sich die Verhaltenstherapie weiterentwickelt und ist zu einem integrativen Ansatz ausdifferenziert worden. In drei Phasen lassen sich zentrale Entwicklungen beschreiben:
- Behaviorale Phase: Analyse und Veränderung des Verhaltens
- Kognitive Phase: Einbeziehung von Gedanken, Überzeugungen und Schemata
- Moderne integrative Phase: Einbezug emotionaler Prozesse sowie Themen wie Achtsamkeit und Akzeptanz
Wir halten es für entscheidend, Verhalten, Gedanken und Emotionen gleichermaßen in die Therapie einzubeziehen. Besonderen Wert legen wir darauf, die Behandlung individuell an den Problemen, Bedürfnissen und Zielen der Patient*innen auszurichten. Ziel ist, Leiden und Beeinträchtigungen zu verringern und die Lebensqualität langfristig zu verbessern, indem Strategien vermittelt werden, die auch über die Therapie hinaus helfen, Schwierigkeiten zu bewältigen und Symptome zu lindern.
Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT)
Die DBT wurde Mitte der 1980er Jahre von der amerikanischen Psychologieprofessorin Marsha Linehan zur Behandlung chronisch suizidaler Frauen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt. Heute gilt sie weltweit als das wissenschaftlich am besten abgesicherte Therapieverfahren für Menschen jeden Geschlechts mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Grundlage der DBT ist die kognitive Verhaltenstherapie, ergänzt durch Techniken aus verschiedenen Psychotherapieschulen.
Die ambulante DBT besteht aus vier Therapiebausteinen: Einzeltherapie, Skills-Training in der Gruppe, Telefonkontakt im Notfall und regelmäßige fachliche Supervision für die Therapeut*innen.
Die Therapieziele richten sich nach dem Ausmaß und der Art der jeweiligen Problematik. Vorrang hat die Behandlung von Symptomen und Verhaltensmustern, die das Leben der Betroffenen gefährden oder zu belastenden emotionalen Krisen führen. Außerdem werden frühzeitig Verhaltensmuster bearbeitet, die die effektive Mitarbeit in der Therapie behindern.
Die DBT verfügt über ein umfangreiches Repertoire störungsspezifischer Fertigkeiten (Skills), die gemeinsam mit der Einzeltherapeut*in individuell erarbeitet, geübt und in den Alltag integriert werden.
Traumatherapie
Wir bieten für Menschen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Traumatherapie an, die von der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) anerkannt ist.
Die Behandlung gliedert sich in drei, teilweise ineinander übergehende Phasen:
- Stabilisierungsphase: Zu Beginn der Therapie steht der Aufbau einer stabilen, Sicherheit vermittelnden therapeutischen Beziehung im Vordergrund. Zudem werden Fertigkeiten vermittelt, um mehr Kontrolle über belastende Symptome (z. B. Flashbacks, Alpträume) und über das eigene Verhalten zu entwickeln. In dieser Phase erfolgt auch eine ausführliche Information über Entstehung und Aufrechterhaltung der Posttraumatischen Belastungsstörung.
- Traumabearbeitungsphase: In der zweiten Phase findet ein strukturiertes und kontrolliertes Wiedererleben zentraler Aspekte des Traumas statt, um Verarbeitungsprozesse anzustoßen und eine Integration der Erfahrung in die Gesamtpersönlichkeit zu ermöglichen. Ziel ist, die traumbezogenen Gefühle von denen der gegenwärtigen Realität unterscheiden zu können. Eine Retraumatisierung mit erneutem Kontrollverlust wird vermieden: Die Kontrolle der Klient*innen über den Therapieprozess hat jederzeit Vorrang.
- Integrationsphase: In der dritten Phase liegt der Fokus auf dem Aufbau eines zufriedenstellenden Lebens und der Rückeroberung des Alltags in allen Lebensbereichen.
Schematherapie
Die Schematherapie ist ein integrativer Ansatz der Psychotherapie, der Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie, der Gestalttherapie und der psychodynamischen Verfahren miteinander verbindet. Sie wurde entwickelt, um insbesondere Menschen mit langanhaltenden, tief verwurzelten Problemen, Persönlichkeitsstörungen oder wiederkehrenden Verhaltens- und Beziehungsmustern zu helfen.
Zentrale Annahme der Schematherapie ist, dass sich in der Kindheit und Jugend erlernte, maladaptive Muster – sogenannte „Schemata“ – entwickeln, die das Denken, Fühlen und Handeln im Erwachsenenalter prägen. Diese Schemata können zu belastenden Verhaltensweisen, emotionalen Problemen und Schwierigkeiten in Beziehungen führen.
Ziel der Therapie ist es, diese Schemata zu erkennen, zu verstehen und schrittweise zu verändern. Dabei werden sowohl kognitive als auch emotionale und verhaltensbezogene Techniken eingesetzt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung gesunder Bewältigungsstrategien und auf der Förderung einer stabilen Selbstwahrnehmung.
Die Behandlung erfolgt in der Regel in Einzeltherapie, kann aber bei Bedarf um Elemente der Gruppentherapie ergänzt werden. Im therapeutischen Prozess wird eng an den individuellen Mustern der Klient*innen gearbeitet, wobei die Therapieziele gemeinsam definiert und regelmäßig überprüft werden. Ziel ist die Reduktion von Leidensdruck, die Verbesserung der Lebensqualität und die Förderung langfristig stabiler Veränderungen im Denken, Fühlen und Handeln.
Systemische Therapie und Beratung
Die Systemische Therapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, das die Wechselwirkungen zwischen Individuen und ihrem sozialen Umfeld in den Mittelpunkt stellt. Sie betrachtet psychische Schwierigkeiten nicht isoliert, sondern als Ausdruck von Interaktionen innerhalb von Beziehungen, Familien oder anderen relevanten Systemen. Ziel der Therapie ist es, Verhaltens- und Kommunikationsmuster zu erkennen, zu reflektieren und gemeinsam neue Handlungs- und Lösungswege zu entwickeln.
In der systemischen Arbeit werden sowohl Einzelpersonen als auch Paare, Familien oder Teams einbezogen. Durch gezielte Interventionen und strukturiertes Vorgehen sollen Ressourcen gestärkt, Konflikte lösbar gemacht und die Autonomie der Beteiligten gefördert werden. Dabei orientiert sich die Therapie an den Zielen und Bedürfnissen der Klient*innen und legt Wert auf eine konstruktive Zusammenarbeit, um die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.
Methodisch kommen in der Systemischen Therapie unter anderem Aufstellungen, zirkuläres Fragen, Perspektivwechsel und lösungsorientierte Techniken zum Einsatz. Die Therapie ist in der Regel zeitlich begrenzt, kann jedoch flexibel an den Verlauf und die individuellen Anforderungen angepasst werden.
Klärungsorientierte Psychotherapie (KPT)
Die Klärungsorientierte Psychotherapie (KPT) ist ein kognitiv-therapeutisches Verfahren, das auf der Analyse und Veränderung dysfunktionaler Denkmuster basiert. Ziel der Therapie ist es, die Zusammenhänge zwischen individuellen Überzeugungen, Einstellungen und problematischem Verhalten zu erkennen und daraus Strategien zur Veränderung abzuleiten.
Im Zentrum steht die systematische Klärung der Gedanken und inneren Bewertungen, die das Erleben und Handeln der Klient*innen prägen. Durch reflektierende Gespräche und gezielte Interventionen lernen die Klient*innen, belastende Denk- und Handlungsmuster zu erkennen, alternative Interpretationen zu entwickeln und adaptive Verhaltensweisen einzuüben.